Neue Satellitenwetterstation im Wallis eingeweiht
In Leuk (Kanton Wallis) wurde die neue Satellitenempfangsstation in Zusammenarbeit mit EUMETSAT in Anwesenheit von Bundesrat Alain Berset eingeweiht. Ende 2022 wird der erste Satellit der dritten Generation europäischer Satelliten (Meteosat Third Generation) in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht, was zu noch genaueren Wettervorhersagen und -warnungen beitragen wird.

In Leuk betonte Bundesrat Alain Berset die Bedeutung der internationalen technischen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit beim Betrieb von Wettersatelliten und hob die entscheidende Rolle der Europäischen Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) und deren Aufgabe hervor, den Mitgliedsländern die von Wettersatelliten gesammelten Daten zur Verfügung zu stellen.
Web-site ESA – The European Space Agency (in english)
Meteorologische Satelliten liefern Informationen über die Entwicklung der Wolkendecke, die Wasserdampfkonzentration in der Atmosphäre sowie Temperatur- und Feuchtigkeitsprofile und spielen damit eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Wettervorhersagen, der Verbesserung von Unwetterwarnungen und der Untersuchung des Klimawandels.
Die neueste Generation von Wettersatelliten, die Ende 2022 gestartet wird, verspricht neue Möglichkeiten für die Entwicklung innovativer meteorologischer und klimatologischer Daten und Produkte. Mit Hilfe von Satellitendaten wird es in Zukunft möglich sein, die Aktivität von Gewittern in Sekundenschnelle zu überwachen, die potenzielle Nutzung der Sonnenenergie zu optimieren und beispielsweise die Qualität numerischer Wettervorhersagemodelle zu überprüfen.
Um all diese Vorteile nutzen zu können, muss die Kapazität für den Empfang und die Verarbeitung der Daten erheblich gesteigert werden: die Datenmenge wird mehr als zehnmal so groß sein wie heute. Mit drei Antennen mit einem Durchmesser von 6,5 Metern und modernsten technologischen Standards wird die Station ab dem Zeitpunkt, zu dem der erste Satellit in die Umlaufbahn eintritt, jede Minute eine riesige Datenmenge mit meteorologischen Informationen empfangen und an die EUMETSAT-Zentrale in Darmstadt (Deutschland) übertragen.
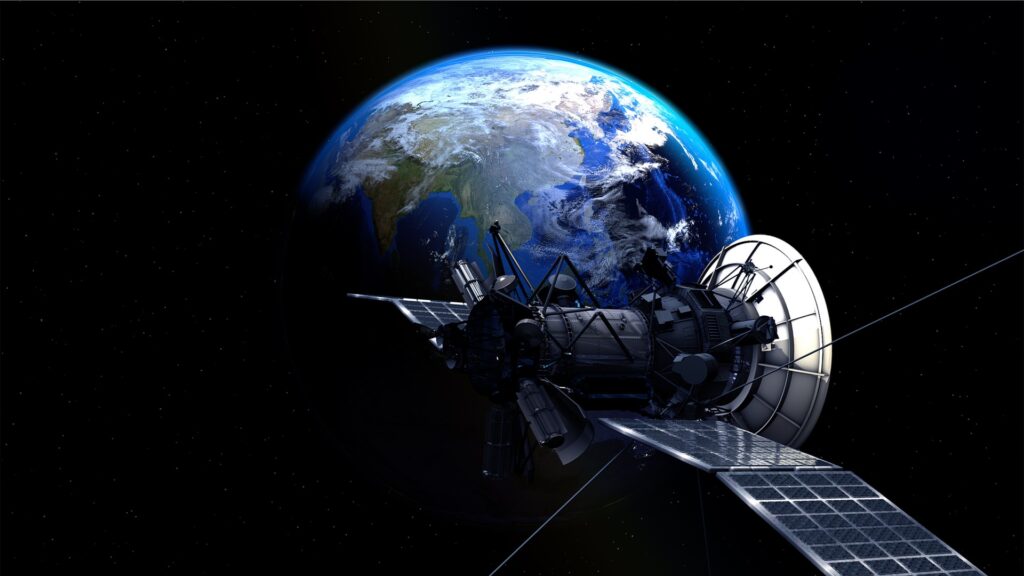
EUMETSAT
Nach der Erfassung der Satellitendaten werden diese an die EUMETSAT-Zentrale in Darmstadt (D) übermittelt, wo sie kalibriert, georeferenziert und anschliessend an die Nutzer, hauptsächlich nationale Wetterdienste und private Wetterdienstleister, verteilt werden. Nach der Weiterverarbeitung stellt MeteoSchweiz ihren internen und externen Kunden wie Vorhersagediensten, automatischen Nowcasting-Systemen, Klimaforschern oder den Medien verschiedene Satellitenprodukte zur Verfügung.
Unter Messwerte stellt MeteoSchweiz alle 15 Minuten aktualisierte Satellitenbilder der Wolkenverteilung kostenlos zur Verfügung. Unter Service & Publikationen können Sie viele weitere Satellitenbilder gegen eine Gebühr beziehen. Diese können speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden und sind mit einer zeitlichen Auflösung von bis zu 5 Minuten erhältlich.

Satellitenbeobachtungen werden immer wichtiger
Zu den Aufgaben von EUMETSAT gehören der Betrieb von Wettersatelliten sowie die Bereitstellung von Beobachtungsdaten und damit verbundenen Dienstleistungen für alle Mitglieder. Darüber hinaus erforscht die Agentur neue Anwendungen für meteorologische Satelliten und erweitert das Dienstleistungsangebot. Die Entwicklung und der Bau neuer Satelliten und Messinstrumente erfordert die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen. So arbeitet EUMETSAT beispielsweise beim Bau von Satelliten intensiv mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zusammen.
Satellitenbeobachtungen
Meteorologische Satelliten spielen eine zentrale Rolle in der Meteorologie, da sie es ermöglichen, die Wettervorgänge in der Atmosphäre rund um die Uhr und auf globaler Ebene zu verfolgen. MeteoSchweiz erhält Satellitendaten von EUMETSAT, einem Konsortium europäischer Länder, das gemeinsam Meteosat und andere meteorologische Satelliten betreibt.
Satellitenbeobachtungen sind für die Erstellung von Wettervorhersagen von entscheidender Bedeutung. Geostationäre Satelliten liefern praktisch in Echtzeit ein genaues Bild des Wetters für sehr große Gebiete der Erde. Meteorologische Satelliten erfassen alle paar Minuten Daten, so dass die Veränderungen in der Atmosphäre kontinuierlich verfolgt werden können. Die Satellitendaten werden von unseren Meteorologen genutzt, um sich einen Überblick über die Wetterlage zu verschaffen. Diese Daten werden auch in automatischen Kurzzeitvorhersagesystemen verwendet und sind für die Initialisierung des numerischen Modells unerlässlich. Auch für die Beobachtung von Klimavariablen gewinnt die Satellitenmeteorologie weltweit an Bedeutung.

Meteosat Zweite Generation (MSG)
MeteoSchweiz verwendet hauptsächlich Messungen von Meteosat Second Generation (MSG)-Satelliten. Die wichtigsten MSG-Satelliten befinden sich in einer geostationären Umlaufbahn in einer Höhe von 36’000 km über dem Schnittpunkt des Äquators mit dem Meridian von Greenwich.
Von dieser Position aus kann ein MSG-Satellit etwa ein Drittel der Erdkugel beobachten. Das Hauptinstrument der zweiten Meteosat-Generation ist eine Multispektralkamera namens SEVIRI (Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager), die über zwölf Kanäle verfügt (8 Infrarot-, 1 Nahinfrarot- und 3 sichtbare Kanäle). Ein MSG-Satellit beobachtet von dieser Position aus die gesamte sichtbare Erdscheibe und nimmt alle 15 Minuten eine Messung vor. Ein zweiter Satellit konzentriert sich auf das nördliche Drittel der sichtbaren Erdscheibe und kann so alle 5 Minuten Europa und den Nordatlantik beobachten. Wenn die Satellitendaten in Form von Bildern dargestellt werden, ermöglichen sie es dem menschlichen Auge, verschiedene Wolkenschichten und andere Phänomene zu erkennen, wie z. B. den Staubtransport in der Sahara oder, dank der Kombination verschiedener Kanäle, Aschewolken von Vulkanen.
Meteosat Dritte Generation (MTG)
Ab 2023 wird die nächste Generation geostationärer Satelliten mit neuen Instrumenten ins All geschossen, die die Erde mit größerer Präzision beobachten können.
Die MTG-Konstellation wird aus vier abbildenden Kamerasatelliten (MTG-I) und zwei Satelliten mit atmosphärischen Vermessungsinstrumenten (MTG-S) bestehen. MTG-I ist mit dem Flexible Combined Imager (FCI) ausgestattet, der eine Weiterentwicklung des SEVIRI-Instruments ist. FCI hat 16 Spektralkanäle (SEVIRI 12), die räumliche Auflösung im Infrarotbereich beträgt 2 km, im sichtbaren Bereich 1 km (die meisten SEVIRI-Kanäle haben eine Auflösung von 3 km). Der erste Satellit wird alle 10 Minuten ein Bild der sichtbaren Scheibe der Erde aufnehmen. Ein zweiter Satellit wird alle 2,5 Minuten das obere Viertel der Erdkugel beobachten. Dieser Satellit wird vier Kanäle mit einer doppelt so hohen räumlichen Auflösung erfassen, wodurch er in der Lage sein wird, sich schnell entwickelnde Gewitter mit großer Präzision zu beobachten. MTG-I hat auch ein neuartiges Instrument an Bord, den Lighting Imager (LI), mit dem zum ersten Mal die Blitzaktivität in Europa aus dem Weltraum aufgezeichnet werden kann. Die MTG-S-Mission zur Vermessung der Atmosphäre wird mit zwei Spektrometern ausgestattet sein. Das Infrarotspektrometer (IRS) misst Temperatur- und Feuchtigkeitsprofile, während das UVN-Spektrometer zur Überwachung der Luftqualität und der chemischen Zusammensetzung der Atmosphäre dient.





